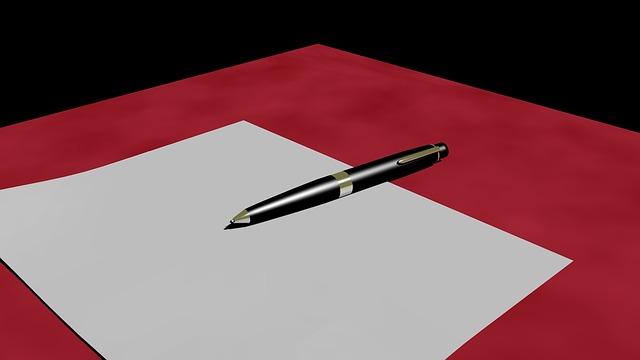Im Gegensatz zu den klassischen Lagerstätten ist das unkonventionelle Erdgas in Kohle-, Ton- oder Schiefergestein in großen Tiefen eingeschlossen. Nur mit aufwändiger Technik kann es gefördert werden. Es reicht nicht aus, die Lagerstätte einfach anzubohren, sondern die Gesteinsformationen müssen durch sogenanntes „Hydraulic Fracturing“ – kurz „Fracking“ – zerstört werden, um ein Herausströmen des Gases zu ermöglichen. Dabei werden große Mengen Wasser versetzt mit einem Cocktail von mehr als 200 verschiedenen Chemikalien unter hohem Druck in den Boden gepumpt und anschließend Sprengungen durchgeführt. Als Wasserzusätze werden Xylol, Toluol, Benzol und andere wassergefährdende Chemikalien eingesetzt. Sie sind toxisch, teilweise kanzerogen und biozid. In den USA, wo die Technik seit langem eingesetzt wird, sind unzählige Störfälle aktenkundig. Kritiker halten die potenziellen Gefahren der Förderung aus unkonventionellen Erdgaslagerstätten deshalb für zu hoch und für nicht kalkulierbar. Sie fordern Umweltverträglichkeitsprüfungen und eingehende wissenschaftliche Untersuchungen noch vor der ersten Probebohrung. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), geschweige denn eine Bürgerbeteiligung, sieht das antiquierte Bundesberggesetz aber für Erkundungsbohrungen erst gar nicht vor. Erst die Gewinnung von Erdgas erfordert eine UVP, aber auch nur dann, wenn das tägliche Fördervolumen 500.000 Kubikmeter Erdgas übersteigt. ( Anmerkung: geschätzt werden 5.000- 30.000 m³ )
Für weitere Informationen empfehlen wir:
- den Monitorbeitrag aus November 2010
- sowie die Dokumentation Gasrausch, der auf 3SAT ausgestrahlt wurde.